Ursachen von Hörverlust und Hörstörungen
Die Ursachen von Hörproblemen sind so vielfältig wie ihre Erscheinungsweise. So müssen Hörverluste nicht immer beide Ohren betreffen, umfassen oft völlig verschiedene Frequenzbereiche und sind entweder irreversibel oder reversibel. Am häufigsten ist zwar die altersbedingte Schwerhörigkeit, jedoch sind Hörminderungen weiter verbreitet, als man denkt und treten oft – bemerkt oder unbemerkt – bereits in jungen Jahren auf.
In diesem Beitrag erfahren Sie,
- wie Hörverluste überhaupt entstehen,
- wie sich Schallleitungs-, Schallempfindungs- und Schallwahrnehmungsstörungen unterscheiden und was hinter Hörstörungen wie
- Lärmschwerhörigkeit, Hörsturz, Tinnitus und
- Hörverlust durch Otosklerose steckt.
Wie Hörverluste entstehen: Schallempfindung, Schallleitung und Schallwahrnehmung
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen schallleitungsbedingten und schallempfindungs- bzw. schallwahrnehmungsbedingten Hörverlusten. In bestimmten Fällen können diese auch kombiniert auftreten.
-
Schallempfindungsstörung
Bei einer Schallempfindungsstörung, auch sensineuraler Hörverlust genannt, sind die Haarsinneszellen im Innenohr geschädigt – etwa durch Abnutzung im Alter (Presbyakusis), durch konstanten Lärm, einen Hörsturz, Infektionen, Entzündungen oder Kopfverletzungen. Dadurch kann der Schall nicht mehr vollständig weitergeleitet werden. Auch Schäden am Hörnerv können eine Schallempfindungsstörung nach sich ziehen.
-
Schallleitungsstörung
Bei der Schallleitungsstörung ist wiederum die mechanische Schallübertragung beeinträchtigt – sei es durch Krankheiten wie Otosklerose, Mittelohrentzündungen, gutartige Tumoren, Fehlbildungen von Ohrmuschel oder Gehörgang oder auch einfach nur durch einen verstopften bzw. verengten Gehörgang.
-
Schallwahrnehmungsstörung
Bei einer Schallwahrnehmungsstörung kann das Gehirn eingehende Signale nicht mehr richtig verarbeiten. Die Ursachen reichen hier von Krankheiten wir Gehirnhautentzündung (Enzephalitis) über Schädel-Hirn-Traumen, Hirnblutungen und Schlaganfällen bis hin zu angeborenen Fehlbildungen sowie Nebenwirkungen von Medikamenten.
Lärmschwerhörigkeit
Neben altersbedingten Hörverlusten zählt die Lärmschwerhörigkeit zu den häufigsten Hörminderungen. Konstante Lärmbelastungen von mehr als 85 Dezibel (etwa bei der Arbeit in Industriebetrieben, Baustellen, im Eventbereich oder durch lauten Verkehr), aber auch einzelne, intensive Lärmerlebnisse (etwa durch Explosionen) können die Haarsinneszellen im Innenohr schädigen.
Man unterscheidet hier zwischen
- vorübergehender und
- dauerhafter Lärmschwerhörigkeit.
Ein vorübergehender Hörverlust, der zum Beispiel nach einem Konzert auftritt, kann durch Ruhe und vom Arzt verordnete Medikamente oft wieder verschwinden. Sind die Haarsinneszellen jedoch irreparabel geschädigt, hilft nur noch ein Hörgerät, um den Hörverlust auszugleichen. Wie Sie Ihr Gehör vor Lärm und äußeren Einflüssen schützen können, erfahren Sie in diesem Betrag.
 © iStock/9parusnikov
© iStock/9parusnikovHörsturz
Unter einem Hörsturz (auch Ohrinfarkt genannt) versteht man eine abrupt auftretende, sensorineurale Hörminderung. Betroffene hören plötzlich schlechter oder nehmen Töne als fremd bzw. äußerst unangenehm wahr, in manchen Fällen stellt sich sogar eine komplette Taubheit ein.
In den meisten Fällen tritt der Hörverlust nur einseitig auf, oft verbunden mit Tinnitus, Schwindel und einem pelzigen, watteartigen Gefühl im bzw. rund ums Ohr.
Bei Symptomen eines Hörsturzes gilt: So schnell wie möglich zum HNO-Arzt! in jedem Fall: Sofort ab zum HNO-Arzt! Denn: Wird ein Hörsturz rechtzeitig behandelt, kann ein bleibender Hörverlust oft verhindert werden.
Die Auslöser bzw. Risikofaktoren für einen Hörsturz sind vielfältig und reichen von Krankheiten wie Diabetes, Infektionen, Autoimmunerkrankungen bis hin zu konstantem Stress. Ursache für den Ohrinfarkt sind Durchblutungsstörungen im Innenohr: Werden die Haarsinneszellen der Cochlea (Gehörschnecke) nicht ausreichend mit Blut und dadurch mit zu wenig Sauerstoff versorgt, setzen sie ihre Funktion aus bzw. sterben im schlimmsten Fall ab, was einen dauerhaften Hörverlust nach sich ziehen kann.
-
Sowohl Dauer als auch Verlauf können bei Hörstürzen völlig unterschiedlich sein.
-
In vielen Fällen heilt ein Ohrinfarkt nach wenigen Tagen ohne bleibende Hörminderung aus.
-
Oft wird bei Hörstürzen ausschließlich Ruhe abseits lauter Umgebungen als Therapiemaßnahme verordnet.
-
Es können aber auch Medikamente, ein- bzw. mehrmalige Infusionen oder spezielle Therapieverfahren zum Einsatz kommen.
Um das Risiko eines Hörsturzes zu mindern, empfehlen Experten einen bewussten Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung und einem möglichst niedrigen Stresslevel.
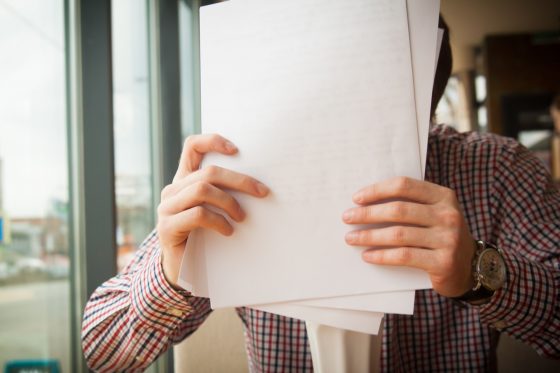 © Unsplash/Tetiana SHYSHKINA
© Unsplash/Tetiana SHYSHKINATinnitus
Unter Tinnitus versteht man Ohrgeräusche ohne externe Schallquelle. Jeder Tinnitus ist individuell, so hören Betroffene z. B. ein entweder konstantes oder hin und wieder auftretendes Klingeln, Rauschen, Pfeifen, Summen, Knacken oder Pochen in einem oder in beiden Ohren bzw. mittig im Kopf. Bei manchen ändern sich die wahrgenommenen Töne von Zeit zu Zeit in ihrer Art bzw. Tonhöhe. Individuell ist auch die Lautstärke des Tinnitus – manche hören den Ton im Ohr nur, wenn es rundherum ganz still ist, andere nehmen in selbst in lauten Umgebungen wahr, bei anderen wiederum tritt er vor allem in Stresssituationen zu Tage.
Fakt ist: Tinnitus ist keine eigene Krankheit, sondern ein Symptom. Gründe für einen Tinnitus sind so vielfältig wie sein Erscheinungsbild selbst. So können die Ursachen sowohl im Ohr selbst als auch in den Nerven oder im Gehirn liegen.
Je nach Wahrnehmung unterscheidet man bei Tinnitus zwischen
- objektiven Ohrgeräuschen, die auch von außen hör- und messbar sind und z. B. durch Abnutzungen oder Verspannungen des Kiefers, Gefäßverengungen im Innenohr, Verschmutzungen im Gehörgang oder ein nicht funktionierender Verschluss der Ohrtrompete (Eustachische Röhre) oder
- subjektiven Ohrgeräuschen, die wesentlich häufiger vorkommen. In diesem Fall wird der Tinnitus ausschließlich vom Betroffenen wahrgenommen und ist von außen nicht messbar, was sowohl die Einschätzung des Schweregrades als auch die Behandlung erschwert. Meist liegt die durch Tests feststellbare Lautstärke in etwa 10-15 dB über der Hörschwelle. Die Gründe für einen subjektiven Tinnitus sind vielfältig und geben der Wissenschaft teils immer noch Rätsel auf. Sie reichen von Stress über Hörverluste, fehlerhafte Hörverarbeitung im Mittelohr bis hin zu Wahrnehmungsstörungen im Großhirn.
Eine weitere Differenzierung von Tinnitus erfolgt nach der Dauer der Ohrgeräusche:
-
Akut
Ein akuter Tinnitus entsteht häufig spontan und besteht nicht länger als drei Monate.
-
Subakut
Bei einem subakuten Tinnitus treten die Symptome innerhalb von drei Monaten bis zu einem Jahr immer wieder einmal auf.
-
Chronisch
Von einem chronischen Tinnitus spricht man, wenn die Ohrgeräusche länger als ein Jahr bestehen.
Auch wenn Tinnitus an sich nur ein Symptom und deshalb nicht gefährlich ist, stellen vor allem chronische Ohrgeräusche für viele Betroffene eine große Herausforderung dar. Nicht selten ziehen die konstanten Ohrgeräusche Schlafstörungen, Ängste bis hin zu psychischen Erkrankungen nach sich.
Ein Allheilmittel für Tinnitus gibt es leider noch nicht, allerdings kann vielen Betroffenen mittlerweile durch moderne Therapieansätze geholfen werden. Die Therapiemöglichkeiten für Tinnitus richten sich nach Art, Intensität und (sofern bekannt) Auslöser der Ohrgeräusche. Mehr zum Thema Tinnitus-Therapie und Retraining finden Sie hier.
 © Unsplash/Christopher Jolly
© Unsplash/Christopher JollyOtosklerose
Rund einer von 250 Menschen erkrankt im Laufe seines Lebens an Otosklerose, wobei Frauen fast doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Dabei verwachsen die Gehörknöchelchen durch krankhafte Verhärtungen bzw. Verknöcherungen mit dem umgebenden Knochen. Normalerweise sind die Gehörknöchelchen – Hammer, Amboss und Steigbügel – beweglich und leiten durch Schwingung den Schall ans Innenohr weiter.
Mit zunehmenden Verwachsungen durch Otosklerose werden die Gehörknöchelchen (am häufigsten betroffen ist der Steigbügel) irgendwann unbeweglich, wodurch der Schall nicht mehr vollständig weitergeleitet wird. Die Folge ist ein zunehmender Hörverlust, in diesem Fall als Schalleitungsschwerhörigkeit bezeichnet.
Typische Anzeichen für Otosklerose sind
- ein zunehmender Hörverlust, der meist auf einem Ohr beginnt,
- häufig verbunden mit Tinnitus, Ohrensausen oder Schwindel.
- Viele Betroffene können in geräuschvollen Umgebungen besser hören und sprechen außergewöhnlich leise, da sie die eigene Stimme über die Knochenweiterleitung als lauter wahrnehmen.
-
Eine Otosklerose festzustellen, ist nicht immer einfach – vor allem, weil bei Untersuchungen sowohl Trommelfell, Mittelohr als auch Ohrtrompete oft unauffällig erscheinen.
-
Den eindeutigen Nachweis, ob eine Otosklerose besteht oder nicht, liefern erst audiometrische Messungen wie Tonschwellen- oder Impedanzaudiometrie.
-
Für eine endgültige Diagnose sind dennoch oft noch weiterführende Tests wie Gleichgewichtsprüfung, Ohrröntgen oder eine TCS (tympano-cochleäre Szintigrafie) notwendig.
-
Wie Otosklerose entsteht, ist noch nicht vollständig geklärt. Man nimmt an, dass sowohl Vererbung als auch virale Infektionen bzw. hormonelle Faktoren eine Rolle spielen.
Im Rahmen der Otosklerose-Operation wird meist der obere Teil des Steigbügels entfernt und eine Prothese eingesetzt, die dafür sorgt, dass die Schwingungen der Gehörknöchelchenkette wieder ins Innenohr gelangen.
Sollte die Operation nicht möglich sein bzw. die betroffene Person diese nicht wollen, kann zumindest der Hörverlust durch Hörgeräte ausgeglichen werden.
Auch #sehenswert

Alle Arten von Hörgeräten im Überblick

Hörschwäche: Ab wann brauche ich ein Hörgerät?

